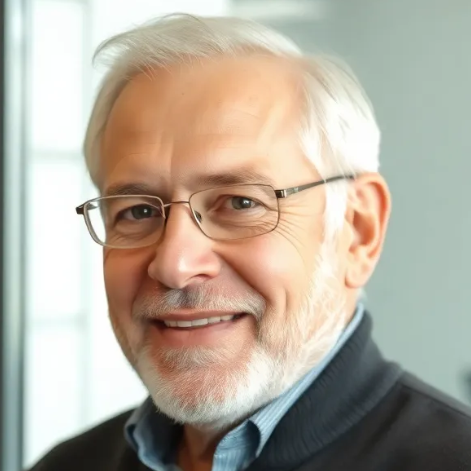Ein Schlaganfall kommt meist ohne Vorwarnung – als plötzliche Unterbrechung der Blutversorgung im Gehirn. Etwa 85 bis 90 Prozent aller Fälle sind ischämisch bedingt, ausgelöst durch Thromben oder Embolien. Die restlichen 10 bis 15 Prozent gehen auf hämorrhagische Ereignisse zurück, meist infolge von Gefäßrupturen bei Hypertonie oder Aneurysmen.
Die Folgen reichen von motorischen Einschränkungen (zum Beispiel Hemiparese, Spastik) über Sprach- und Schluckstörungen bis hin zu kognitiven Defiziten. Die Rehabilitation ist komplex – und genau hier setzt die Akupunktur an: als integrativer Baustein im multimodalen Therapiekonzept.
Qi-Stagnation und „innere Winde“ – der Blick der TCM
In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) gilt der Schlaganfall (Zhong Feng) nicht als singuläres Ereignis, sondern als Ausdruck eines gestörten inneren Gleichgewichts. Häufige Ursachen: aufgestautes Leber-Yang, blockiertes Qi, Schleimakkumulation oder ein „Angriff des Windes“.
Ziel der Akupunktur ist es, diese Blockaden aufzulösen, den Qi- und Blutfluss zu harmonisieren, Yin und Yang wieder in Einklang zu bringen – und so den Körper bei der Selbstregulation zu unterstützen. Doch wie sieht das in der Praxis aus?
Phase ist nicht gleich Phase – wann akupunktieren?
1. Akutphase (0–48 Stunden):
In chinesischen Kliniken wird teils schon auf der Stroke Unit mit Akupunktur begonnen. Studien weisen darauf hin, dass frühe Interventionen – insbesondere innerhalb der ersten 72 Stunden – neuroplastische Prozesse anstoßen und Komplikationen wie Spastik abschwächen können. Wichtig: enge interdisziplinäre Abstimmung!
2. Subakutphase (2 Wochen – 6 Monate):
Dies ist die zentrale Phase der funktionellen Rehabilitation. Hier entfaltet Akupunktur ihr volles Potenzial – in Kombination mit Physio- und Ergotherapie. Sie kann helfen, Beweglichkeit zu verbessern, die Sprachfähigkeit zu fördern und Fatigue zu lindern.
3. Chronische Phase (>6 Monate):
Auch bei langanhaltenden Defiziten – etwa Spastiken oder Erschöpfung – zeigt sich Akupunktur als wertvolle Ergänzung. Studien berichten über positive Effekte auf Lebensqualität und Mobilität.
Punktgenau: bewährte Rezepturen und Techniken
Körperakupunktur:
LI4 (Hegu): Qi-Regulation, schmerzlindernd
GB34 (Yanglingquan): Stärkung von Sehnen und Muskulatur
ST36 (Zusanli): Tonisierung von Qi und Blut, Aufbaukraft
EX-HN3 (Yintang): Beruhigung, Förderung geistiger Klarheit
Schädelakupunktur:
Besonders wirksam bei motorischen Ausfällen: Areale wie MS6 und MS7 nach Jiao Shunfa, direkt über dem sensomotorischen Kortex, sprechen gezielt Hirnareale an. Klinisch gut belegt bei Hemiparesen.
Elektroakupunktur (EA):
Durch niederfrequenten Strom (2–100 Hz) lässt sich die Wirkung deutlich intensivieren. EA zeigt laut Studien Verbesserungen bei Gangbild, Muskeltonus und Schmerzempfinden. Hinweis: Vorsicht bei Epilepsie oder Antikoagulation!
Evidenz: was die Forschung sagt
Die Studienlage entwickelt sich dynamisch:
Cochrane Review (2005): erste Hinweise auf motorischen Nutzen, aber mit methodischen Schwächen
Zhang et al. (2021): neuere Metaanalyse mit signifikanten Effekten auf Gehgeschwindigkeit, Fatigue und Lebensqualität
fMRT-Studien: zeigen klare Aktivierungsveränderungen im motorischen Kortex nach Akupunktur
WHO: führt Schlaganfallrehabilitation seit 2003 offiziell als Indikation
Die wissenschaftliche Community wird zunehmend hellhörig – vor allem, wenn es um Kombinationstherapien geht.
Praxisintegration: so läuft’s in der Klinik
Immer mehr neurologische Rehabilitationszentren in Deutschland setzen auf Akupunktur. Typisches Beispielprotokoll:
Frequenz: 2–3 Behandlungen pro Woche
Dauer: über 6–8 Wochen
Taktik: morgens Akupunktur, nachmittags aktive Therapie (z. B. Lokomotionstraining)
Dokumentation: nach DEAA-Standards, inkl. Feedback zu Wirkungen und Nebenwirkungen
Sicherheit und Grenzen
Akupunktur gilt als nebenwirkungsarm. Zu beachten:
Mögliche Reaktionen: leichte Hämatome, Müdigkeit, vegetative Reaktionen
Kontraindikationen:
- Gerinnungsstörungen / Antikoagulation
- Offene Hautläsionen an Punktionsstellen
- Epilepsie (v. a. bei EA)
In jedem Fall ist eine gründliche Anamnese und ärztliche Rücksprache essenziell.
Wohin geht die Reise?
Trotz vielversprechender klinischer Ergebnisse steht die Akupunkturforschung in der Schlaganfallrehabilitation noch am Anfang. Es mangelt an groß angelegten, methodisch hochwertigen randomisierten Studien, die belastbare Aussagen zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erlauben. Künftige Forschung sollte sich verstärkt darauf konzentrieren, die zugrunde liegenden Wirkmechanismen – etwa über BDNF, Synaptogenese oder das Mikrobiom – besser zu verstehen. Auch die langfristigen Effekte über einen Zeitraum von zwölf Monaten und darüber hinaus sind bislang kaum untersucht. Ein weiteres zentrales Zukunftsthema ist die Individualisierung von Akupunkturprotokollen – basierend auf genetischen Dispositionen, Konstitutionstypen und dem individuellen Therapieansprechen. Nur so lässt sich das volle Potenzial dieser Therapieform in der neurorehabilitativen Versorgung ausschöpfen.
Akupunktur ist kein Wundermittel – aber ein hochwirksames, sicheres Werkzeug im Werkzeugkasten der Rehabilitationsmedizin. Ihr größter Vorteil: Sie dockt an Körper, Geist und Energiesystem zugleich an. Wer Schlaganfallpatientinnen und -patienten ganzheitlich begleiten will, sollte Akupunktur als festen Bestandteil des Reha-Plans denken.